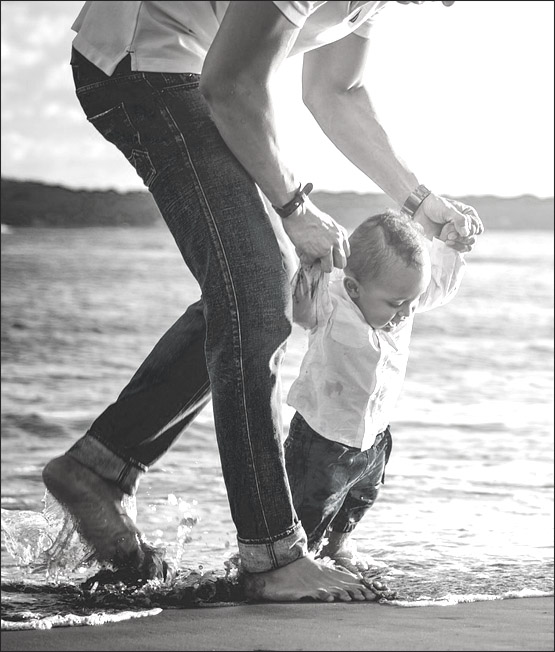Das Sorgerecht ist statistisch gesehen das meist umkämpfte Recht In Deutschland. Nach Art. 6, Abs. 2 des Grundgesetzes haben Eltern das Recht und die Pflicht, für ihr minderjähriges Kind zu sorgen, es zu erziehen und zu fördern, unabhängig davon, ob sie mit dem Kind zusammen leben oder nicht. Mit Sorgerecht wird das Recht eines oder beider Elternteile bezeichnet, ihre Kinder im jeweils eigenen Haushalt zu versorgen und zu erziehen. Maßgeblich ist im gesamten Kindschaftsrecht das Kindeswohl.
DAS SORGERECHT UMFASST:
I. Personensorge |
III. Vermögenssorge |
MEHR ZUM SORGERECHT
I. Personensorge
Aufenthaltsbestimmungsrecht
Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist Teil der Personensorge. Sorgeberechtigte Eltern haben nach § 1631 BGB die Pflicht und das Recht, ihr Kind zu beaufsichtigen und seinen Aufenthaltsort zu bestimmen. Dies betrifft auch die Bestimmung des Ortes, an dem das Kind Freizeit und Urlaub verbringt. Bei all diesen Entscheidungen muss nach § 1697a BGB des Kindschaftsrechts das Kindeswohl immer im Vordergrund stehen. Haben die Eltern ein gemeinsames Sorgerecht, müssen sie einvernehmlicch entscheiden. Das gilt sowohl für verheiratete als auch für unverheiratete oder geschiedene Eltern. Ein Elternteil bestimmt nur dann allein den Aufenthaltsort seines Kindes, wenn er allein das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat oder wenn beide Elternteile sich vorab, um danach weniger zu streiten, einzelne Entscheidungsbefugnisse in einer Sorgerechtsvollmacht gegenseitig übertragen haben. Auch in letzterem Fall bleibt jedoch das Umgangsrecht des Elternteils ohne Aufenthaltebestimmungsbefugnis unberührt.
Wenn verheiratete Eltern sich trennen oder scheiden lassen, muss der künftige Aufenthaltsort der Kinder bestimmt werden. Zwar bleibt der Lebensmittelpunkt der Kinder nicht automatisch bei dem Elternteil, der fortan in der Ehewohnung lebt. Dennoch folgt man oft der Maßgabe, dass Kinder möglichst nicht aus ihrer gewohnten Umgebung genommen werden und ihre sozialen Kontakte (z.B. Freunde aus KITA oder Schule) erhalten bleiben. Geschwister sollen nicht auseinander gerissen werden. Im Idealfall einigen sich beide sorgeberechtigte Elternteile auf ein sog. Wechselmodell, bei dem sich die Kinder abwechselnd mal bei dem einen, mal bei dem anderen Elternteil aufhalten.
Sofern ein Elternteil das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht beim Familiengericht beantragt, muss er dem Gericht darlegen, dass der andere Elternteil dem Kindeswohl nicht gerecht wird und ungeeignet ist, seine Kinder angemessen zu betreuen (z.B. wegen Gewaltausbrüchen und/oder Alkoholismus). Im Verfahren vor dem Familiengericht haben Kinder ab 14 Jahre ein Anhörungsrecht. Gegen ihren Willen trifft das Gericht in der Regel keine Entscheidungen.
Sorgeberechtigte Eltern, solange sie in der Lage sind, die Personensorge für ihr Kind verantwortungsvoll auszuüben, haben gegenüber jedem, der ihnen das Kind vorenthalten will, einen gesetzlichen Anspruch (§ 1632 BGB) auf Herausgabe des Kindes. Das können Personen sein, die das Kind für eine Weile in Pflege hatten und sich weigern, das Kind wieder seinen Sorgeberechtigten zurück zu geben.
Umgangsbestimmungsrecht
Das Umgangsbestimmungsrecht ist ein weiterer selbstständiger Teil der Personensorge. Sorgeberechtigte dürfen nach § 1632 Abs. 2 BGB festlegen, mit wem ihre minderjährigen Kinder wann und wie lange Umgang haben können. Diese Befugnis wird jedoch eingeschränkt durch das Grundrecht beider Elternteile auf Umgang mit ihren Kindern. Umgekehrt haben Kinder ein Grundrecht auf Umgang mit beiden Elternteilen. Das müssen Sorgeberechtigte bei der Ausübung ihres Umgangsbestimmungsrechts berücksichtigen. Ggf. haben auch weitere nahestehende Personen ein Umgangsrecht, wenn zwischen ihnen und den Kindern soziale Beziehungen bestehen.
Steht die elterliche Sorge einem Elternteil allein zu, ist dieser befugt, den Umgang eines Kindes mit dem anderen Elternteil zwar zu regeln, jedoch nicht zu unterbinden. Das Grundrecht auf Umgang mit seinem Kind kann dem nicht sorgeberechtigten Elternteil nur dann verweigert werden, wenn eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt. Ein nicht Sorgeberechtigter darf allerdings keine wichtigen Entscheidungen im Leben des Kindes treffen.
Das Umgangsbestimmungsrecht ist der fragilste Teil des Sorgerechts. Es gilt nur solange sich die Eltern grundsätzlich einig sind. Sobald dies aus dem Lot gerät und ein nicht sorgeberechtigter, in seinen Recht am Umgang behinderter Elternteil sich an das Familiengericht wendet, kann für das Kind ein "Anwalt des Kindes", ein Verfahrensbeistand bestellt werden, der anstelle der Eltern für das Kind entscheidet, mit wem wieviel Umgang ihm am besten tut.
Das Umgangsbestimmungsrecht kann vom Familiengericht im Fall von Kindeswohlgefährdung auch gesondert entzogen werden In kritischen Fällen kann vom Gericht ein sog. Umgangspfleger eingesetzt werden, der Häufigkeit, Dauer, Zeit und den Ort bestimmt, an dem ein Umgang stattfindet und den Umgang ggf. begleitet. Der Umgangspfleger entscheidet auch, welcher Umgang im besonderen Fall ausgeschlossen wird.
Erziehung
Bei möglicherweise vielen unterschiedlichen Erziehungsstilen, über die sorgeberechtigte Eltern zusammen streiten können, sollte ihr gemeinsamer Nenner zumindest sein, ihre Kinder ernst zu nehmen und sich ihr Vertrauen zu verdienen.
religiöse Erziehung
Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht müssen zudem gemeinsam ggf. über eine religiöse Erziehung ihrer Kinder entscheiden. Ist nur ein Elternteil gläubig oder gehören sie zwei verschiedenen Religionen an, ist eine Einigung in dieser Frage oft schwer. Bei unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten kann das Familiengericht die alleinige Entscheidungsbefugnis in dieser Frage auf nur ein Elternteil übertragen. Die Gerichte entscheiden hier im Einzelfall.
Dies sind dabei hauptsächlich die Kriterien:
-
Kindeswohl
Es findet der Kindeswille auch jüngerer Kinder Berücksichtigung
-
eine kontinuierliche Erziehung
Richtungswechsel sollen vermieden werden - die soziale Umgebung
der Elternteil, bei dem die Kinder leben, erhält vorrangig das Entscheidungsrecht
Kinder dürfen ab einem bestimmten Alter (mit)entscheiden, ob überhaupt oder welcher Religion sie ggf. zugehören wollen. Der § 5 RelErzG bestimmt feste Altersgrenzen.
Religionsmündigkeit von Kindern:
-
Kinder ab 14 Jahren gelten als religionsmündig
Ab diesem Alter haben Eltern kein Mitspracherecht mehr.
-
bei 12 - 14-jährigen
dürfen Eltern nicht gegen den Willen des Kindes einen religiösen Richtungswechsel beschließen
- bereits 10-jährige Kinder
müssen bei einem Streit der Eltern über ihre Religionszugehörigkeit gehört werden
Auswahl von KITA und Schule
KITA
Die Bestimmung der KITA für gemeinsame Kinder, ob die Kimder überhaupt in eine KITA gehen sollen, führt besonders bei getrennt lebenden Eltern leicht zu Konflikten. Denn schon durch die Entscheidung für eine bestimmte KITA werden Weichen für die künftige Entwicklung des Kindes gestellt. Es bleibt aber gemeinsam sorgeberechtigten Eltern wenig anderes übrig, als zu versuchen, sich über Meinungsverschiedenheiten hinweg zu einigen. Denn beide müssen schließlich die Anmeldung bei einem Kindergarten unterzeichnen. Helfen könnte Eltern in einer solchen Konfliktsituation wie hier eine sog. Sorgerechtsvollmacht, unterzeichnet zu einem Zeitpunkt, an dem sich noch kein akuter Konflikt aufgetan hat. Durch eine Sorgerechtsvollmacht wird jewels einer der beiden Sorgeberechtigten bevollmächtigt, in bestimmten Belangen allein zu entscheiden. Denkbar ist auch eine Vereinbarung, in der für bestimmte Belange dem einen, für andere Belange dem anderen Elternteil die alleinige Entscheidungsbefugnis eingeräumt wird. - Ein Wechsel der KITA ist bei Umzug oft nicht zu vermeiden. Fühlt sich aber ein Kind in einer KITA bereits wohl, soll ihm möglichst kein Wechsel zugemutet werden.
Schulanmeldung in Berlin
Anders als bei der Anmeldung in einer KITA, wo bei gemeinsam sorgeberechtigten Eltern jeder Elternteil unterzeichnen muss, ist das bei der Anmeldung an einer Berliner Schule nicht mehr notwendig. Nach § 88, Abs. 4 Satz 1 des Berliner Schulgesetzes wird vermutet, dass ein Elternteil bei gemeinsamem Sorgerecht auch für den anderen handelt, wenn er das Kind an einer Schule anmeldet.. Das gilt sowohl für die Anmeldung an Grundschulen, als auch für weiterführende Schulen. Der allein unterzeichnende Elternteil muss nicht mehr ausdrücklich erklären, auch im Namen des anderen sorgeberechtigten Elternteils zu handeln.
Gesundheitssorge
Sorgeberechtigte haben eine Pflicht zur Gesundheitssorge für ihr Kind. Gemeinsam sorgeberechtigte Eltern müssen auch gemeinsam Entscheidungen für oder gegen von Ärzten vorgeschlagene oder für notwendig erachtete medizinische Behandlungen des Kindes treffen. Grundsätzlich ist zur Behandlung Minderjähriger immer die Einwilligung beider sorgeberechtigter Elternteile erforderlich. Im Zweifelsfall und auf Antrag eines Elternteils übertragen Familiengerichte bei Gefährdung der kindlichen Gesundheit das Recht zur Gesundheitssorge oder gar das gesamte Sorgerecht im Wege der einstweiligen Anoprdnung auf nur ein Elternteil.
Die Verweigerung von notwendigen medizinischen Behandlungen (z.B. aus re&mundschaftsgericht kann die elterliche Sorge einschränken, wenn sichdie Sorgeberechtigten bezüglich einer dringend notwendigen Therapie uneins sind und dem Kind deswegen ein Schaden droht. Ist das Leben des Kindes akut bedroht, muss ein Arzt, unter Berufung auf einen übergesetzlichen Notstand zur Rettung des Kindes auch gegen den Willen der Eltern die erforderliche Behandlung durchführen.
Namensrecht
Den Vornamen für ein Kind können Sorgeberechtigte frei bestimmen. Die Wahlfreiheit endet jedoch da, wo durch den Namen möglicherweise das Kindeswohl gefährdet sein könnte. Auch hier müssen gemeinsam Sorgeberechtigte sich einig werden.
Regeln für die Wahl des Vornamens für ein Kind:
-
Der Vorname muss als Name erkennbar sein
- Anstößige oder lächerliche Vornamen können das Kindeswohl verletzen, sind deswegen tabu
-
Der Vorname darf kein Ortsname oder Familienname sein.
-
Fünf Vornamen sind das Maximum.
Kinder von Müttern mit alleinigem Sorgerecht bekommen zunächst den Nachnamen ihrer Mutter. Mit Zustimmung des nicht sorgeberechtigten Vaters kann sie dem Kind aber auch seinen Nachnamen geben. Übernehmen nach der Geburt beide Eltern das Sorgerecht, können sie den Nachnamen ihres Kindes innerhalb von drei Monaten neu bestimmen. - Kinder von verheirateten Eltern erhalten automatisch deren Familiennamen. Allerdings können Kinder keinen zusammengesetzten Doppelnamen von den Eltern übernehmen (z.B. "Müller-Schneider"). Haben die Eltern ihren eigenen Nachnamen beibehalten, darf das Kind nur einen der beiden Nachnamen bekommen. Die Eltern müssen sich auf einen Nachnamen für ihr Kind einigen. Diese Entscheidung gilt auch für den Nachnamen von möglichen weiteren Kindern.
Nach einem neuen Gesetzesentwurf sollen künftig Scheidungskinder ihren (Nach)namen einfacher ändern können.
II. rechtliche Vertretung
Inhaber des Sorgerechts sind implizit gesetzliche Vertreter des Kindes. Ein minderjähriges Kind kann bis auf wenige Ausnahmen selbst keine Verträge abschließen, die ohne Zustimmung gesetzlicher Vertreter Geltung erlangen. Ein Kind ist insofern beschränkt geschäftsfähig. Kinder können zwar Geschäfte tätigen. Wenn jedoch die Eltern nicht bestätigen, dass sie mit diesem Geschäft einverstanden sind, ist das Geschäft nichtig. Von den Eltern im Namen des Kindes vorgenommene Rechtshandlungen wirken für oder auch gegen das Kind. Das heisst, ein etwaiges Verschulden seines rechtlichen Vertreters kann zu einem Schaden für das Kind führen. Darum ist es geboten, dass Eltern verantwortungsbewusst handeln, wenn sie ihre minderjährigen Kinder rechtlich vertreten.
III. Vermögenssorge
Sorgeberechtigte Eltern haben das Recht und die Pflicht, das Vermögen ihrer minderjährigen Kinder zu verwalten und zu erhalten. Die Vermögenssorge ist zumindest so lange kein Problem, als weder Kind noch Familiengericht Fragen stellen. Dennoch sollte mit dem Vermögen der Kinder verantwortungsvoll umgegangen werden. Entscheidend ist vor allem anderen, dass das gute Verhältnis zu ihnen keinen Schaden nimmt!
Dabei müssen Sorgeberechtigte beachten:
-
Vermögenswerte des Kindes müssen wirtschaftlich sinnvoll angelegt werden. Riskante Geschäfte dürfen nicht ohne Zustimmung des Familiengerichts getätigt werden.
-
Kollidieren anderweitige Interesen von Sorgeberechtigten mit den Interessen des Kindes, muss es im betreffenden Bereich von einem Rechtspfleger, den das Familiengericht bestellt, vertreten werden.
-
Schenkungen dürfen im Namen des Kindes nur angenommen werden, wenn sie rechtlich vorteilhaft sind. Sofern man nicht sicher davon ausgehen kann, ist die Annahme der Schenkung genehmigungspflichtig.
-
Vom Vermögen des Kindes dürfen keine Schenkungen an Dritte gemacht werden
-
Keiner Genehmigung bedarf es, wenn Sorgeberechtigte eine Erbschaft für das minderjährige Kind ausschlagen wollen, die sie zuvor auch für sich selbst ausgeschlagen haben.
-
Sofern ein Elternteil gegen die Vermögensinteressen des Kindes handelt, kann ihm auf Antrag die Vermögenssorge entzogen werden. Zumindest können einschränkende Auflagen angeordnet werden.
Zu folgenden riskanten Rechtsgeschäften mit dem Vermögen des Kindes brauchen Sorgeberechtigte nach §§ 1821, 1822 BGB eine Genehmigung durch das Familiengericht:
-
Sorgeberechtigte wollen eine Immobilie aus dem Vermögen des Kindes verkaufen oder mit einer Grundschuld belasten ...
-
... oder sie wollen das gesamte Vermögen des Kindes in einem Wertpapier anlegen.
-
... oder sie wollen das Kind zu einer Bürgschaft verpflichten
-
... oder sie möchten einen Mietvertrag abschließen, durch den das Kind zur Mietzahlung verpflichtet wird.
-
... oder sie möchten für das Kind eine Erbschaft ausschlagen
Das Recht auf Vermögenssorge ist aufgehoben, zumindest eingeschränkt:
- wenn das Kind mit Zustimmung der Sorgeberechtigten ein Arbeitsverhältnis eingeht und diesbezüglich voll geschäftsfähig handelt.
-
Das Familiengericht muss eine Genehmigung erteilen, wenn Sorgeberechtigte ihre minderjährigenm Kinder dazu ermächtigen wollen, ein Erwerbsgeschäft selbstständig zu betreiben. (§ 112 BGB)
-
wenn das Kind die Mittel (z.B. für bestimmte Käufe) selbst beschafft hat, z.B. durch Ersparnisse vom Taschengeld. (§ 110 BGB, Taschengeld betreffend)
Gemeinsames Sorgerecht verheirateter
und geschiedener Eltern
Beide Eltern haben automatisch ein gemeinsames Sorgerecht, wenn sie bei der Geburt eines Kindes verheiratet sind. Auch wenn sie nach der Geburt eines gemeinsamen Kindes heiraten, erhalten sie ein gemeinsames Sorgerecht. Nach einer Trennung oder Scheidung behalten beide dieses Recht und die Verantwortung für die Kinder. Durch eine Scheidung ändert sich daran zunächst nichts. Über alltägliche Dinge wie z.B. Essgewohnheiten, Sport, die Schlafenszeit und den Medienkonsum des Kindes kann der betreuende Elternteil, bei dem das Kind hauptsächlich wohnt, in der Regel eigenständig bestimen. Bei Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung müssen die Sorgeberechtigten weiterhin gemeinsam entscheiden.
... oder ganz ohne Ehe
Vom Sorgerecht nur für die ledige Mutter ...
Ist die Mutter eines Kindes unverheiratet und gibt es zum Zeitpunkt von dessen Geburt keinen Vater, der mit Zustimmung der Mutter die Vaterschaft anerkennt und verbindlich erklärt, ein gemeinsames Sorgerecht für das Kind oder eine Beteiligung daran anzustreben, erhält automatisch die Mutter allein das Sorgerecht.
... zum gemeinsamem Sorgerecht
Unverheiratete Eltern können jedoch beim Jugendamt oder bei einem Notar einvernehmlich ihren Willen zur Wahrnehmung gemeinsamer Sorge für ihr gemeinsames Kind erklären. Diese Erklärung kann sowohl vor der Geburt des Kindes als auch jederzeit danach beurkundet werden. Erklären sich die Eltern schon vor der Geburt des Kindes, muss nur noch die Geburtsurkunde alsbald nach der Geburt an das Jugendamt, bzw. an den beurkundenden Notar nachgereicht werden.
Mit gemeinsamem Sorgerecht haben beide Elternteile die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl des Kindes auszuüben. Ein Antrag auf gemeinsames Sorgerecht unverheirateter Eltern kann nur dann abgewiesen werden, wenn mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass eine gemeinsame Sorge mit dem Kindeswohl nicht zu vereinbaren wäre.
Sofern die Mutter einem gemeinsamen Sorgerecht nicht zustimmt, kann (seit 2010) der nicht mit ihr verheiratete Kindsvater auch ohne ihre Zustimmung beim Familiengericht ein gemeinsames, bzw. geteiltes Sorgerecht beantragen. Wenn entgegenstehende Gründe nicht von vornherein ersichtlich sind, bestimmt das Familiengericht eine Frist, innerhalb der einem gemeinsamen Sorgerecht widersprechende Gründe vorgetragen werden können. Geschieht dies nicht, beschließt das Familiengericht ein gemeinsames Sorgerecht in einem vereinfachten Verfahren, in dem weder das Jugendamt noch die Eltern nochmals angehört werden. Sofern es nicht dem Kindeswohl widerspricht, überträgt das Gericht alsdann die elterliche Sorge auf beide Eltern.
Sorgerechtsvollmacht
Das gemeinsame Sorgerecht für gemeinsame Kinder erfordert sehr viele einvernehmliche Entscheidungen von den Eltern. Davon können sie im Alltag überfordert sein. Durch eine vorab erteilte Sorgerechtsvollmacht kann im Hinblick auf genau bestimmte Angelegenheiten das alleinige Entscheidungsrecht auf einen Elternteil übertragen werden. Mit dieser Vollmacht, die der Partner, der auf sein Entscheidungsrecht verzichtet, dem anderen ausstellt, lassen sich künftige Streitigkeiten in den bezeichneten Angelegenheiten am ehesten vermeiden. So kann auch vermieden werden, dass ein Gericht in der Sache entscheiden muss. Denkbar sind hier auch gegeseitig erteilte Vollmachten.
Alleiniges Sorgerecht
Sind die Eltern jedoch sehr zerstritten, sodass Einigungen zwischen ihnen nicht zustande kommen oder ein Elternteil wird seinen Pflichten als Sorgeberechtigter nicht gerecht, kann es zum Wohle von Kindern besser sein, wenn die Entscheidungsbefugnis in einzelnen Angelegenheiten oder die elterliche Sorge sogar insgesamt auf nur einen Elternteil übertragen wird. Dies muss jedoch beim zuständigen Familiengericht beantragt werden.
Bei Folgendem z.B. kann einem Elternteil das Sorgerecht vom Gericht entzogen werden:
-
Kindeswohlgefährdung
Wenn fürsorgliches Handeln durch Sorgeberechtigte unterlassen wird.
-
Kindesmisshandlung
Wenn das Kind körperlichen Misshandlungen (Schlägen, Tritten etc.), sexuellen Misshandlungen und/oder emotionalen Misshandlungen (Herabsetzung, Entwertung, Beschimpfungen etc.) ausgesetzt ist